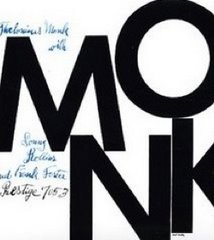Georg Simmel: Soziologische Aesthetik

Die Betrachtung des menschlichen Tuns verdankt ihren immer erneuten Reiz der unerschöpflich mannigfaltigen Mischung von gleichartiger, steter Wiederkehr weniger Grundtöne und wechselnder Fülle ihrer individuellen Variierungen, deren keine ganz der anderen gleicht.
Auf eine erstaunlich geringe Zahl ursprünglicher Motive lassen sich die Tendenzen, Entwicklungen, Gegensätze der Menschengeschichte zurückführen.
Was man von der Dichtung behauptet hat: dass sowohl Lyrik wie Dramatik nur in der wechselnden Ausgestaltung einer eng begrenzten Zahl äusserer und innerer Schicksalsmöglichkeiten bestünden. -
Das gilt von jedem Gebiete menschlicher Betätigung; und je weiter wir die Gebiete fassen, desto mehr schmilzt die Zahl der Grundmotive zusammen, um schliesslich bei der allgemeinsten Betrachtung des Lebens fast überall nur in eine Zweiheit zu münden, als deren Kampf, Kompromiss, Kombination zu immer neuen Gestalten alles Leben erscheint.
Auf solchen Dualismus von Denk- und Lebensrichtungen, in dem die Grundströmungen des Menschlichen zu ihrem einfachsten Ausdruck kämen, strebt jede Epoche, die unübersehbare Fülle ihrer Erscheinungen zurückzuführen.
Nur aber in Symbolen und Beispielen ist jener tiefe Lebensgegensatz alles Menschlichen zu begreifen und jeder grossen historischen Periode erscheint eine andere Ausgestaltung dieses Gegensatzes als sein Grundtypus und Urform.
So tauchte am Anfang der griechischen Philosophie der grosse Gegensatz zwischen Heraklit und den Eleaten auf: für jenen war alles Sein in ewigem Flusse; in der Mannigfaltigkeit unendlicher Kontraste, die sich unaufhörlich in einander umsetzen, vollzieht sich ihm der Weltprozess; für die Eleaten dagegen gab es jenseits des trüglichen Sinnenscheines nur ein einziges ruhendes Sein, allumfassend, ungespalten, die absolute, unterschiedlose Einheit der Dinge.
Das war die Grundform, die die grosse Parteiung alles menschlichen Wesens für das griechische Denken annahm und die das Thema für seine gesamte Entwickelung gab.
Mit dem Christentum trat eine andere Ausgestaltung auf: der Gegensatz des göttlichen und des irdischen Prinzips.
Allem spezifisch christlichen Leben erschien Dies als der letzte und absolute Gegensatz der Wesensrichtungen, auf den alle Unterschiede des Wollens und Denkens zurückgeführt werden mussten, der aber selbst auf keinen tieferen mehr hinwies.
Die Lebensanschauungen der neueren Zeit haben Das zu dem fundamentalen Gegensatz von Natur und Geist weitergeführt.
Die Gegenwart endlich hat für jenen Dualismus, der zwischen die Menschen, ja, durch die einzelne Seele seine Furche zieht, die Formel der sozialistischen und der individualistischen Tendenz gefunden.
Hiermit scheint wiederum ein letzter typischer Unterschied der Charaktere von Menschen und Einrichtungen ausgesprochen, eine Wasserscheide gefunden, an der ihre Richtungen sich trennen, um dann, doch wieder zusammenfliessend, die Wirklichkeit nach den verschiedenen Massen ihrer Mitwirkung zu bestimmen.
Durch alle Fragen des Lebens scheint sich die Linie zu verlängern, die diese Denkweisen trennt und auf den entferntesten Gebieten, an den mannigfaltigsten Materien zeigt sich die Form der Charakterbildung, die sich auf dem sozialpolitischen in dem Gegensatz sozialistischer und individualistischer Neigungen ausprägt.
Sie bestimmt nicht weniger die Tiefen rein materieller Lebensinteressen als die Höhen der ästhetischen Weltanschauung.
Das Wesen der ästhetischen Betrachtung und Darstellung liegt für uns darin, dass in dem Einzelnen der Typus, in dem Zufälligen das Gesetz, in dem Äusserlichen und Flüchtigen das Wesen und die Bedeutung der Dinge hervortreten.
Dieser Reduktion auf Das, was an ihr bedeutsam und ewig ist, scheint keine Erscheinung sich entziehen zu können.
Auch das Niedrigste, an sich Hässlichste, lässt sich in einen Zusammenhang der Farben und Formen, der Gefühle und Erlebnisse einstellen, der ihm reizvolle Bedeutsamkeit verleiht; in das Gleichgültigste, das uns in seiner isolierten Erscheinung banal oder abstossend ist, brauchen wir uns nur tief und liebevoll genug zu versenken, um auch Dies als Strahl und Wort der letzten Einheit aller Dinge zu empfinden, aus der ihnen Schönheit und Sinn quillt und für die jede Philosophie, jede Religion, jeder Augenblick unserer höchsten Gefühlserhebungen nach Symbolen ringen.
Wenn wir diese Möglichkeit ästhetischer Vertiefung zu Ende denken, so gibt es in den Schönheitswerten der Dinge keine Unterschiede mehr.
Die Weltanschauung wird ästhetischer Pantheismus, jeder Punkt birgt die Möglichkeit der Erlösung zu absoluter ästhetischer Bedeutsamkeit, aus jedem leuchtet für den hinreichend geschärften Blick die ganze Schönheit, der ganze Sinn des Weltganzen hervor.
Damit aber hat das Einzelne die Bedeutung verloren, die es gerade als Einzelnes und im Unterschiede gegen alles Andere besitzt.
Denn nicht so lässt diese sich bewahren, dass man etwa sagte, die überall gleich mögliche ästhetische Formung und Vertiefung der Dinge lasse der inhaltlichen, qualitativen Verschiedenheit ihrer Schönheiten vollen Raum, sie bedeute nur ästhetische Gleichwertigkeit, nicht Gleichartigkeit, sie hebe nur die Unterschiede des Ranges auf diesem Gebiete auf, aber nicht die der Farben und Töne, der Sinne und Gedanken, des Allegro und des Adagio.
Diese Vorstellung, die die Reize der ästhetischen Allgleichheit und Alleinheit mit denen des ästhetischen Individualismus versöhnen will, tut doch dessen Forderung nicht ganz Genüge.
Denn gerade die Rangordnung der Werte, der Aufbau des Bedeutsamen über das Gleichgültigere, die organische Steigerung und Entwicklung, die aus dein Stumpfen das Beseelte, aus dem Rohen das Feine herauswachsen lässt, gibt den Gipfeln dieser Reihe einen Hintergrund, eine Höhe und Leuchtkraft, die bei ästhetischer Gleichwertigkeit der Objekte von keinem unter ihnen erreicht wird.
Für sie ergiesst sich ein gleich heller Glanz über alle Dinge, der zwar das Niedrigste dem Höchsten gleichstellt, dafür aber auch das Höchste dem Niedrigsten.
An Unterschiede sind unsere Empfindungen geknüpft, die Wertempfindung nicht weniger als die des Haut- oder Wärmesinnes.
Wir können nicht immer auf gleicher Höhe wandeln, wenigstens nicht auf der höchsten, die uns in unseren besten Augenblicken zugänglich ist; und so müssen wir die Erhebung des Niedrigsten in die ästhetische Höhe mit dem Verzicht auf jene Aufschwünge bezahlen, die nur seltene, vereinzelte sein können und sich nur über den Untergrund einer tiefer gelegenen, dumpferen und dunkleren Welt erheben.
Aber nicht nur diese Bedingtheit alles Empfindens durch den Unterschied, die wir als abzustreifende Fessel und Unvollkommenheit unseres Wesens empfinden mögen, knüpft den Wert der Dinge an ihren Abstand von einander: auf eben diesem Abstand an und für sich ruht ein Schönheitwert.
Dass die Welt nach Licht und Finsternis geschieden ist, dass ihre Elemente nicht in Gleichwertigkeit formlos in einander verschwimmen, sondern jedes in einem Stufenbau der Werte seine Stelle habe zwischen einem höheren und einem tieferen, dass das Rohere und Niedere den Sinn seiner Existenz darin finde, Träger und Hintergrund des Feinen, Hellen, Hohen zu sein: Das ist an sich ein höchster ästhetischer Reiz und Wert des Weltbildes.
So scheiden sich unversöhnliche Wege: Der, dem tausend Tiefen lohnen, um der einen Höhe willen, und der den Wert der Dinge in ihrem Gipfel findet, von dem er zurückstrahlend allem Niederen seinen Sinn und sein Wertmass zuteilt, - er wird nie den Anderen verstehen, der aus dem Wurm die Stimme Gottes reden hören will und den Anspruch jedes Dinges, so viel zu gelten wie das andere, als Gerechtigkeit empfindet.
Und wer das Schauspiel der Gliederung und Abstufung, der Formung des Weltbildes nach dem Mehr oder Minder ihrer Schönheit nicht entbehren mag, - Der wird nie in einer inneren Welt leben mit dem Anderen, der die Harmonie der Dinge in ihrer Gleichheit sieht, so dass Reiz und Hässlichkeit des Anblickes, törichtes Chaos und sinnvolle Form nur verhüllende Gewänder sind, hinter denen er überall die selbe Schönheit und Seele des Seins sieht, nach der sein Gemüt dürstet.
Hier nach einer Versöhnung zu suchen, nach einem Begriff und Theorie, die diese Gegenrichtungen der Wertgefühle als verträgliche und in einer höheren Strebung zusammenlaufende demonstriert, weil in vielen Seelen tatsächlich beide mit geteilten Rechten herrschen: Das ist so viel wie: den Gegensatz von Tag und Nacht hinweg beweisen, weil es eine Dämmerung gibt.
Hier stehen wir an den Quellen alles Menschlichen, die je nach den Gebieten, durch die sie fliessen, die ungeheuren Gegensätze des politischen Sozialismus und Individualismus, der pantheistischen oder atomistischen Erkenntnis, der ästhetischen Ausgleichung oder Differenzierung aufblühen lassen.
Diese Quellen selbst, diese letzten Wesensrichtungen, können wir nicht mit Worten bezeichnen; nur an jenen einzelnen Erscheinungen, die sie in ihrer Lenkung der empirischen Lebensinhalte, gleichsam in der Mischung mit diesen, ergeben, kann man sie erkennen oder wenigstens auf sie hinweisen als auf die unbekannten Kräfte, die die Materie unseres Daseins zu ihren Formen gestalten, ewig unversöhnt und eben dadurch jede der anderen den frischen Reiz erregend, der dem Leben unserer Gattung seine Rastlosigkeit, seinen Kampf, sein Schwingen zwischen Gegensätzen verbürgt, so dass die Befriedigung des Einen den kräftigsten Ansturm des Anderen lockt.
Und hierin allein liegt, was man ihre Versöhnung nennen könnte: nicht in dem öden Nachweis, dass sie sich auf eine begriffliche Einheit reduzieren lassen, sondern darin, dass sie sich in einer Gattung von Wesen, ja, in jeder einzelnen Seele fortwährend begegnen und bekämpfen.
Denn Das eben ist die Höhe und Herrlichkeit der Menschenseele, dass ihr lebendiges Leben, ihre unbegriffene Einheit, in jedem Augenblick die Kräfte in sich wirken lässt, die an sich doch aus völlig unvereinbaren Quellen nach völlig unvereinbaren Mündungen fliessen.
Am Anfang aller ästhetischen Motive steht die Symmetrie.
Um in die Dinge Idee, Sinn, Harmonie zu bringen, muss man sie zunächst symmetrisch gestalten, die Teile des Ganzen unter einander ausgleichen, sie ebenmässig um einen Mittelpunkt herum ordnen.
Die formgebende Macht des Menschen gegenüber der Zufälligkeit und Wirrnis der bloss natürlichen Gestaltung wird damit auf die schnellste, sichtbarste und unmittelbarste Art versinnlicht.
So führt der erste ästhetische Schritt über das blosse Hinnehmen der Sinnlosigkeit der Dinge hinaus zur Symmetrie, bis später Verfeinerung und Vertiefung gerade wieder an das Unregelmässige, an die Asymmetrie, die äussersten ästhetischen Reize knüpft.
In symmetrischen Bildungen gewinnt der Rationalismus zuerst sichtbare Gestalt.
So lange das Leben überhaupt noch triebhaft, gefühlsmässig, irrationell ist, tritt die ästhetische Erlösung von ihm in so rationalistischer Form auf.
Wenn Verstand, Berechnung, Ausgleichung es erst durchdrungen haben, flieht das ästhetische Bedürfnis wiederum in seinen Gegensatz und sucht das Irrationale und seine äussere Form, das Unsymmetrische.
Die niedrigere Stufe des ästhetischen Triebes spricht sich im Systembau aus, der die Objekte in ein symmetrisches Bild fasst.
So brachten z. B. Bussbücher des sechsten Jahrhunderts die Sünden und Strafen in Systeme von mathematischer Präzision und ebenmässigem Aufbau.
Der erste Versuch, die sittlichen Irrungen in ihrer Gesamtheit geistig zu bewältigen, erfolgte so in der Form eines möglichst mechanischen, durchsichtigen, symmetrischen Schemas; wenn sie unter das Joch des Systems gebeugt waren, konnte der Verstand sie am Schnellsten und gleichsam mit dem geringsten Widerstande erfassen.
Die Systemform zerbricht, sobald man der eigenen Bedeutsamkeit des Objektes innerlich gewachsen ist und sie nicht erst aus einem Zusammenhang mit anderen zu entlehnen braucht; in diesem Stadium verblasst deshalb auch der ästhetische Reiz der Symmetrie, mit der man sich die Elemente zunächst zurechtlegte.
Man kann nun an der Rolle, die die Symmetrie in sozialen Gestaltungen spielt, recht erkennen, wie scheinbar rein ästhetische Interessen durch materielle Zweckmässigkeit hervorgerufen werden und umgekehrt ästhetische Motive in die Formungen hineinwirken, die scheinbar der reinen Zweckmässigkeit folgen.
Wir finden z. B. in den verschiedensten alten Kulturen die Zusammenschliessung von je zehn Mitgliedern der Gruppe zu einer besonderen Einheit - in militärischer, steuerlicher, kriminalistischer und sonstigen Beziehungen -, oft so, dass zehn solcher Untergruppen wieder eine höhere Einheit, die Hundertschaft, bilden.
Der Grund dieser symmetrischen Konstruktion der Gruppe war sicher die leichtere Übersichtlichkeit, Bezeichenbarkeit, Lenksamkeit.
Das eigentümlich stilisierte Bild der Gesellschaft, das bei diesen Organisationen herauskam, ergab sich als Erfolg blosser Nützlichkeiten.
Wir wissen aber ferner, dass diese Bedeutung der »Hundert« schliesslich oft nur noch zur Konservierung der blossen Bezeichnung führte: jene Hundertschaften enthielten oft mehr, oft weniger als hundert Individuen.
Im mittelalterlichen Barcelona z. B. hiess der Senat die Einhundert, obgleich er etwa zweihundert Mitglieder hatte.
Diese Abweichung von der ursprünglichen Zweckmässigkeit der Organisation, während doch zugleich deren Fiktion festgehalten wurden, zeigt den Übergang des bloss Nützlichen in das Ästhetische, den Reiz der Symmetrie, der architektonischen Neigungen im sozialen Wesen.
Die Tendenz zur Symmetrie, zu gleichförmiger Anordnung der Elemente nach durchgehenden Prinzipien, ist nun weiterhin allen despotischen Gesellschaftsformen eigen.
Justus Möser schrieb 1772: »Die Herren vom General-Departement möchten gern Alles auf einfache Regeln zurückgeführt haben. Dadurch entfernen wir uns von dem wahren Plane der Natur, die ihren Reichtum in der Mannigfaltigkeit zeigt, und bahnen den Weg zum Despotismus, der Alles nach wenigen Regeln zwingen will.«
Die symmetrische Anordnung macht die Beherrschung der Vielen von einem Punkt aus leichter.
Die Anstösse setzen sich länger, widerstandsloser, berechenbarer durch ein symmetrisch angeordnetes Medium fort, als wenn die innere Struktur und die Grenzen der Teile unregelmässig und fluktuierend sind.
So wollte Karl V. alle ungleichmässigen und eigenartigen politischen Gebilde und Rechte in den Niederlanden nivellieren und diese zu einer in allen Teilen gleichmässigen Organisation umgestalten; »er hasste«, so schreibt ein Historiker dieser Epoche, »die alten Freibriefe und störrischen Privilegien, die seine Ideen von Symmetrie störten.«
Und mit Recht hat man die ägyptischen Pyramiden als Symbole des politischen Baues bezeichnet, den die grossen orientalischen Despoten aufführten: eine völlig symmetrische Struktur der Gesellschaft, deren Elemente nach oben hin an Umfang schnell abnehmen, an Höhe der Macht schnell zunehmen, bis sie in die eine Spitze münden, die gleichmässig das Ganze beherrscht.
Ist diese Form der Organisation auch aus ihrer blossen Zweckmässigkeit für die Bedürfnisse des Despotismus hervorgegangen, so wächst sie doch in eine formale, rein ästhetische Bedeutung hinein: der Reiz der Symmetrie, mit ihrer inneren Ausgeglichenheit, ihrer äusseren Geschlossenheit, ihrem harmonischen Verhältnis der Teile zu einem einheitlichen Zentrum wirkt sicher in der ästhetischen Anziehungskraft mit, die die Autokratie, die Unbedingtheit des einen Staatswillens auf viele Geister, ausübt.
Deshalb ist die liberale Staatsform umgekehrt der Asymmetrie zugeneigt.
Ganz direkt hebt Macaulay, der begeisterte Liberale, Das als die eigentliche Stärke des englischen Verfassungslebens hervor. »Wir denken«, so sagt er, »gar nicht an die Symmetrie, aber sehr an die Zweckmässigkeit; wir entfernen niemals eine Anomalie, bloss weil es eine Anomalie ist; wir stellen keine Normen von weiterem Umfang auf, als es der besondere Fall, um den es sich gerade handelt, erfordert. Das sind die Regeln, die im Ganzen, vom König Johann bis zur Königin Viktoria, die Erwägungen unserer 250 Parlamente geleitet haben.«
Hier wird also das Ideal der Symmetrie und logischen Abrundung, die allem Einzelnen von einem Punkte aus seinen Sinn gibt, zu Gunsten jenes anderen verworfen, das jedes Element sich nach seinen eigenen Bedingungen unabhängig ausleben und so natürlich das Ganze eine regellose und ungleichmässige Erscheinung darbieten lässt.
Dennoch liegt auch in dieser Asymmetrie, dieser Befreiung des individuellen Falles von der Präjudizierung durch sein Pendant, ein ästhetischer Reiz neben all ihren konkreten Motiven.
Dieser Oberton klingt deutlich aus den Worten Macaulays heraus; er stammt aus dem Gefühl, dass diese Organisation das innere Leben des Staates zum typischsten Ausdruck und in die harmonischste Form bringe.
Am Entschiedensten wird der Einfluss ästhetischer Kräfte auf soziale Tatsachen in dem modernen Konflikt zwischen sozialistischer und individualistischer Tendenz sichtbar.
Dass die Gesellschaft als Ganzes ein Kunstwerk werde, in dem jeder Teil einen erkennbaren Sinn vermöge seines Beitrages zum Ganzen erhält; dass an Stelle der rhapsodischen Zufälligkeit, mit der die Leistung des Einzelnen jetzt zum Nutzen oder zum Schaden der Gesamtheit gereicht, eine einheitliche Direktive alle Produktionen zweckmässig bestimme, dass statt der kraftverschwendenden Konkurrenz und des Kampfes der Einzelnen gegeneinander eine absolute Harmonie der Arbeiten eintrete - diese Ideen des Sozialismus wenden sich zweifellos an ästhetische Interessen und - aus welchen sonstigen Gründen man auch seine Forderungen verwerfen mag - sie widerlegen jedenfalls die populäre Meinung, dass der Sozialismus, ausschliesslich den Bedürfnissen des Magens entsprungen, auch ausschliesslich in sie münde; und die soziale Frage ist nicht nur eine ethische, sondern auch eine ästhetische.1)
Die rationelle Organisation der Gesellschaft hat, ganz abgesehen von ihren fühlbaren Folgen für die Individuen, einen hohen ästhetischen Reiz; sie will das Leben des Ganzen zum Kunstwerk machen, wie es jetzt kaum das Leben des Einzelnen sein kann.
Je zusammengesetztere Gebilde unsere Anschauung zu umfassen befähigt ist, desto entschiedener wird die Anwendung der ästhetischen Kategorien von den individuellen, sinnlich wahrnehmbaren zu den sozialen Gebilden aufwärts schreiten.
Es handelt sich hier um den gleichen ästhetischen Reiz wie den, den die Maschine auszuüben vermag.
Die absolute Zweckmässigkeit und Zuverlässigkeit der Bewegungen, die äusserste Verminderung der Widerstände und Reibungen, das harmonische Ineinandergreifen der kleinsten und der grössten Bestandteile: Das verleiht der Maschine selbst bei oberflächlicher Betrachtung eine eigenartige Schönheit, die die Organisation einer Fabrik in erweitertem Masse wiederholt und die der sozialistische Staat im allerweitesten wiederholen soll.
Dieses eigentümliche, auf Harmonie und Symmetrie hingebende Interesse, in dem der Sozialismus seinen rationalistischen Charakter zeigt und mit dem er das soziale Leben gleichsam stilisieren will, tritt rein äusserlich darin hervor, dass sozialistische Utopien die lokalen Einzelheiten ihrer Idealstädte oder -staaten immer nach dem Prinzip der Symmetrie konstruieren: entweder in Kreisform oder in quadratischer Form werden die Ortschaften oder Gebäude angeordnet.
In Campanellas Sonnenstaat ist der Plan der Reichshauptstadt mathematisch abgezirkelt, eben so wie die Tageseinteilung der Bürger und die Abstufung ihrer Rechte und Pflichten.
Dieser allgemeine Zug sozialistischer Pläne zeugt nur in roher Form für die tiefe Anziehungskraft, die der Gedanke der harmonischen, innerlich ausgeglichenen, allen Widerstand der irrationalen Individualität überwindenden Organisation des menschlichen Tuns ausübt, - ein Interesse, das, ganz jenseits von den materiell greifbaren Folgen solcher Organisation, sicher auch als ein rein formal ästhetisches einen nie ganz verschwindenden Faktor in den sozialen Gestaltungen bildet.
Wenn man die Anziehungskraft des Schönen darein gesetzt hat, dass seine Vorstellung eine Kraftersparnis des Denkens bedeute, das Abrollen einer maximalen Anzahl von Vorstellungen mit einem Minimum von Anstrengung, so erfüllt die symmetrische, gegensatzfreie Konstruktion der Gruppe, wie der Sozialist sie erstrebt, diese Forderung vollkommen.
Die individualistische Gesellschaft mit ihren heterogenen Interessen, mit ihren unversöhnten Tendenzen, ihren unzählige Male begonnenen und - weil nur von Einzelnen getragen - eben so oft unterbrochenen Entwicklungsreihen: eine solche Gesellschaft bietet dem Geiste ein unruhiges, sozusagen unebenes Bild, ihre Wahrnehmung fordert fortwährend neue Innervationen, ihr Verständnis neue Anstrengung; während die sozialistische, ausgeglichene Gesellschaft mit ihrer organischen Einheitlichkeit, ihrer symmetrischen Anordnung, der gegenseitigen Berührung ihrer Bewegungen in gemeinsamen Zentren dem beobachtenden Geist ein Maximum von Wahrnehmungen, ein Umfassen des sozialen Bildes mit einem Minimum von geistigem Kraftaufwand ermöglicht, -eine Tatsache, deren ästhetische Bedeutung viel mehr, als diese abstrakte Formulierung verrät, die psychischen Verfassungen in einer sozialistischen Gesellschaft beeinflussen müsste.
Symmetrie bedeutet im Ästhetischen Abhängigkeit des einzelnen Elementes von seiner Wechselwirkung mit allen anderen, zugleich aber Abgeschlossenheit des damit bezeichneten Kreises; während asymmetrische Gestaltungen mit dem individuelleren Rechte jedes Elementes mehr Raum für frei und weit ausgreifende Beziehungen gestatten.
Dem entspricht die innere Organisation des Sozialismus und die Erfahrung, dass alle historischen Annäherungen an sozialistische Verfassung immer nur in streng geschlossenen Kreisen stattfanden, die alle Beziehungen zu ausserhalb gelegenen Mächten ablehnten.
Diese Geschlossenheit, die sowohl dem ästhetischen Charakter der Symmetrie wie dem politischen Charakter des sozialistischen Staates eignet, hat zur Folge, dass man angesichts des nicht aufzuhebenden internationalen Verkehrs allgemein betont, der Sozialismus könne nur einheitlich in der ganzen Kulturwelt, nicht aber in irgend einem einzelnen Lande zur Herrschaft kommen.
Nun aber zeigt sich die Geltungweite der ästhetischen Motive darin, dass sie sich mit mindestens der gleichen Kraft auch zu Gunsten des entgegengesetzten sozialen Ideals äussern.
Die Schönheit, die heute tatsächlich empfunden wird, trägt noch fast ausschliesslich individualistischen Charakter.
Sie knüpft sich im Wesentlichen an einzelne Erscheinungen, sei es in ihrem Gegensatz zu den Eigenschaften und Lebensbedingungen der Masse, sei es in direkter Opposition gegen sie.
In diesem Sich-Entgegensetzen und Isolieren des Individuums gegen das Allgemeine, gegen das, was für Alle gilt, ruht grossenteils die eigentlich romantische Schönheit, - selbst dann, wenn wir es zugleich ethisch verurteilen.
Gerade dass der Einzelne nicht nur das Glied eines grösseren Ganzen, sondern selbst ein Ganzes sei, das nun als Solches nicht mehr in jene symmetrische Organisation sozialistischer Interessen hineinpasst, - gerade das ist ein ästhetisch reizvolles Bild.
Selbst der vollkommenste soziale Mechanismus ist eben Mechanismus und entbehrt der Freiheit, die, wie man sie auch philosophisch ausdeuten möge, doch als Bedingung der Schönheit erscheint.
So sind denn auch von den in letzter Zeit hervorgetretenen Weltanschauungen die am entschieden individualistischsten: die des Rembrandt und die Nietzsches, durchweg von ästhetischen Motiven getragen.
Ja, so weit geht der Individualismus des modernen Schönheitsempfindens, dass man Blumen, insbesondere die modernen Kulturblumen, nicht mehr zum Strausse binden mag: man lässt sie einzeln, bindet höchstens einzelne ganz lose zusammen.
Jede ist zu sehr Etwas für sich, sie sind ästhetische Individualitäten, die sich nicht zu einer symmetrischen Einheit zusammenordnen; wogegen die unentwickelteren, gleichsam noch mehr im Gattungstypus verbliebenen Wiesen- und Waldblumen gerade entzückende Sträusse geben.
Diese Bindung der gleichartigen Reize an unversöhnliche Gegensätze weist auf den eigentümlichen Ursprung der ästhetischen Gefühle hin.
So wenig Sicheres wir über diesen wissen, so empfinden wir doch als wahrscheinlich, dass die materielle Nützlichkeit der Objekte, ihre Zweckmässigkeit für Erhaltung und Steigerung des Gattungslebens, der Ausgangspunkt auch für ihren Schönheitswert gewesen ist.
Vielleicht ist für uns das schön, was die Gattung als nützlich erprobt hat und was uns deshalb, insofern diese in uns lebt, Lust bereitet, ohne dass wir als Individuen jetzt noch die reale Nützlichkeit des Gegenstandes genössen.
Diese ist längst durch die Länge der geschichtlichen Entwicklung und Vererbung hinweggeläutert; die materiellen Motive, aus denen unsere ästhetische Empfindung stammt, liegen in weiter Zeitenferne und lassen dem Schönen so den Charakter der »reinen Form«, einer gewissen Überirdischheit und Irrealität, wie sich der gleiche verklärende Hauch über die eigenen Erlebnisse vergangener Zeiten legt.
Nun aber ist das Nützliche ein sehr Mannigfaltiges, in verschiedenen Anpassungsperioden, ja, in verschiedenen Provinzen der selben Periode oft von entgegengesetztestem Inhalt.
Insbesondere jene grossen Gegensätze alles geschichtlichen Lebens: die Organisation der Gesellschaft, für die der Einzelne nur Glied und Element ist, und die Wertung des Individuums, für das die Gesellschaft nur Unterbau sei, gewinnen in Folge der Mannigfaltigkeit der historischen Bedingungen abwechselnd die Vorhand und mischen sich in jedem Augenblick in veränderlichsten Proportionen.
Dadurch sind nun die Voraussetzungen gegeben, auf die hin sich die ästhetischen Interessen der einen sozialen Lebensform so stark wie der anderen zuwenden können.
Der scheinbare Widerspruch: dass der gleiche ästhetische Reiz der Harmonie des Ganzen, in dem der Einzelne verschwindet, und dem Sich-Durchsetzen des Individuums zuwächst, erklärt sich ohne Weiteres, wenn alles Schönheitsempfinden das Destillat, die Idealisierung, die abgeklärte Form ist, mit der die Anpassungen und Nützlichkeitsempfindungen der Gattung in dem Einzelnen nachklingen, auf den jene reale Bedeutung nur als eine vergeistigte und formalistische vererbt worden ist.
Dann spiegeln sich alle Mannigfaltigkeiten und alle Widersprüche der geschichtlichen Entwicklung in der Weite unseres ästhetischen Empfindens, das so an die entgegengesetzten Pole der sozialen Interessen die gleiche Stärke des Reizes zu knüpfen vermag.
Die innere Bedeutsamkeit der Kunststile lässt sich als eine Folge der verschiedenen Distanz auslegen, die sie zwischen uns und den Dingen herstellen.
Alle Kunst verändert die Blickweite, in die wir uns ursprünglich und natürlich zu der Wirklichkeit stellen.
Sie bringt sie uns einerseits näher, zu ihrem eigentlichen und innersten Sinn setzt sie uns in ein unmittelbareres Verhältnis, hinter der kühlen Fremdheit der Aussenwelt verrät sie uns die Beseeltheit des Seins, durch die es uns verwandt und verständlich ist.
Daneben aber stiftet jede Kunst eine Entfernung von der Unmittelbarkeit der Dinge, sie lässt die Konkretheit der Reize zurücktreten und spannt einen Schleier zwischen uns und sie, gleich jenem feinen bläulichen Duft, der sich um ferne Berge spinnt.
An beide Seiten dieses Gegensatzes knüpfen sich gleich starke Reize; die Spannung zwischen ihnen, ihre Verteilung auf die Mannigfaltigkeit der Ansprüche an das Kunstwerk, gibt jedem Kunststil sein eigenes Gepräge.
Im Naturalismus, in seinem Gegensatz zu aller eigentlichen »Stilisierung«, scheint zunächst die Nähe der Objekte zu überwiegen.
Die naturalistische Kunst will aus jedem Stückchen der Welt seine eigene Bedeutsamkeit herausholen, während die stilisierende eine vorgefasste Forderung von Schönheit und Bedeutsamkeit zwischen uns und die Dinge stellt.
Aus dem Boden der unmittelbaren Eindrücke von Wirklichkeit ist alle Kunst genährt, wenn sie auch zur Kunst erst da wird, wo sie über diesen Boden hinauswächst; sie setzt eben einen innerlichen, unbewussten Reduktionprozess voraus, um uns von ihrer Wahrheit und Bedeutsamkeit zu überzeugen; bei der naturalistischen Kunst ist diese Reduktion kurz und bequem.
Sie verlangt deshalb keine so entschiedene und weitreichende Selbsttätigkeit des Geniessenden, sondern vollzieht seine Annäherung an die Dinge auf dem direktesten Wege.
Daher nun auch der Zusammenhang, den die naturalistische Kunst vielfach - wenn auch natürlich nicht im Geringsten notwendig - mit sinnlicher Lüsternheit aufweist.
Denn das ist der Punkt, von dem aus am Schnellsten und Unmittelbarsten eine Aufrüttelung des gesamten inneren Systems stattfinden kann: das Objekt und die subjektive Reaktion darauf stehen hier am Nächsten zusammen.
Dennoch entbehrt auch der Naturalismus nicht eines sehr feinen Reizes der Fernwirkung der Dinge, sobald wir auf die Vorliebe achten, mit der er seine Gegenstände im alltäglichsten Leben, im Niedrigen und Banalen, sucht.
Denn für sehr empfindliche Seelen tritt die eigentümliche Entfernung des Kunstwerkes von der Unmittelbarkeit der Erfahrung gerade dann besonders hervor, wenn das Objekt uns ganz nahe steht.
Für weniger zartes Empfinden bedarf es, um es diesen Reiz der Distanz kosten zu lassen, einer grösseren Ferne des Objektes selbst: stilisiert-italienische Landschaften, historische Dramen; je unkultivierter und kindlicher das ästhetische Gefühl ist, desto phantastischer, der Wirklichkeit ferner, muss der Gegenstand sein, an dem das künstlerische Bilden zu seinem Effekt kommt.
Feinere Nerven bedürfen dieser gleichsam materiellen Unterstützung nicht; für sie liegt in der künstlerischen Formung des Objektes der ganze geheimnisvolle Reiz der Distanz von den Dingen, die Befreiung von ihrem dumpfen Druck, der Schwung von der Natur zum Geist; und um so intensiver werden sie das empfinden, an je näherem, niedrigerem, irdischerem Materiale es sich vollzieht.
Man kann vielleicht sagen, dass das Kunstgefühl der Gegenwart im Wesentlichen den Reiz der Distanz stark betont, gegenüber dem Reiz der Annäherung.
Und es weiss sich diesen nicht nur auf dem angedeuteten Wege des Naturalismus zu verschaffen.
Vielmehr bildet diese eigenartige Tendenz, die Dinge möglichst aus der Entfernung auf sich wirken zu lassen, ein vielen Gebieten gemeinsames Zeichen der modernen Zeit.
Ihm gehört die Vorliebe für räumlich und zeitlich entfernte Kulturen und Stile an.
Das Entfernte erregt sehr viele, lebhaft auf- und abschwankende Vorstellungen und genügt damit unserem vielseitigen Anregungsbedürfnis; doch klingt jede dieser fremden und fernen Vorstellungen wegen ihrer Beziehungslosigkeit zu unsern persönlichsten und materiellen Interessen doch nur schwach an und mutet deshalb den geschwächten Nerven nur eine behagliche Anregung zu.
Daher nun auch der jetzt so lebhaft empfundene Reiz des Fragmentes, der blossen Andeutung, des Aphorismus, des Symbols, der unentwickelten Kunststile.
Alle diese Formen, die in allen Künsten heimisch sind, stellen uns in eine Distanz von dem Ganzen und Vollen der Dinge, sie sprechen zu uns »wie aus der Ferne«, die Wirklichkeit gibt sich in ihnen nicht mit gerader Sicherheit, sondern mit gleich zurückgezogenen Fingerspitzen.
Der literarische Stil des Jahrhunderts, dessen letzte Raffinements in Paris und Wien ausgebildet sind, vermeidet die direkte Bezeichnung der Dinge, fasst sie nur an einem Zipfel, streift mit dem Worte nur eine Ecke, der Ausdruck und die Sache decken sich nur mit irgend einem möglichst abgelegenen Stückchen.
Es ist die pathologische Erscheinung der »Berührungsangst«, von der hiermit ein niederer Grad endemisch geworden ist: die Furcht, in allzu nahe Berührung mit den Objekten zu kommen, ein Resultat der Hyperästhesie, der jede unmittelbare und energische Berührung ein Schmerz ist.
Daher äussert sich auch die Feinsinnigkeit, Geistigkeit, differenzierte Empfindlichkeit so überwiegend vieler moderner Menschen im negativen Geschmack, das heisst, in der leichten Verletzbarkeit durch Nicht-Zusagendes, in dem bestimmten Ausschliessen des Unsympathischen, in der Repulsion durch Vieles, ja oft durch das Meiste des gebotenen Kreises von Reizen, während der positive Geschmack, das energische Ja-Sagen, das freudige und rückhaltlose Ergreifen des Gefallenden, kurz die aktiv aneignenden Energien grosse Fehlbeträge aufweisen.
Der Naturalismus in seinen groben Formen war ein verzweifelter Versuch, über die Distanz hinwegzukommen, die Nähe und Unmittelbarkeit der Dinge zu ergreifen; kaum aber war man ihnen ganz nahe, so konnten die empfindlichen Nerven schon ihre Berührung nicht mehr vertragen und scheuten zurück, als hätten sie glühende Kohlen angefasst.
Das gilt nicht nur von der Reaktion in der Malerei, die durch die schottische Schule vermittelt wurde, und in der Literatur, die vom Zolaismus zum Symbolismus führte; es gilt auch von wissenschaftlichen Tendenzen: so, wenn der Materialismus, der die Wirklichkeit unmittelbar zu greifen glaubt, vor »neu-kantischen« oder subjektivistischen Weltanschauungen zurückweicht, die die Dinge erst durch das Medium der Seele brechen oder destillieren lassen, ehe sie zu Erkenntnissen werden; so, wenn sich über der spezialistischen Detailarbeit in allen Wissenschaften der Ruf nach Zusammenfassung und Verallgemeinerung erhebt, die sich in überschauende Distanz von aller konkreten Einzelheit stelle; so, wenn in der Ethik die platte »Nützlichkeit« vor höher aufblickenden, oft religiösen, von der sinnlichen Unmittelbarkeit weit abstehenden Prinzipien zurücktreten muss.
An mehr als einem Punkte unserer Kultur macht sich diese Tendenz auf Distanzierung beherrschend fühlbar; dabei ist es selbstverständlich, dass ich damit ein bestimmt empfundenes, also qualitatives, inneres Verhältnis zu den Dingen meine, das ich nur, weil es keinen direkten Ausdruck dafür gibt, auf das quantitative der Distanzierung zurückführe, das nur als Symbol und Annäherung gelten kann.
Die Auflösung der Familie hängt damit zusammen, die Abneigung gegen »Familiensimpelei«, das Gefühl unerträglicher Enge, das das Gebundensein an den nächsten Kreis so oft im modernen Menschen weckt und ihn so oft in tragische Konflikte verwickelt.
Die Leichtigkeit des Verkehrs in die grösseren Fernen hin verstärkt diese »Berührungsangst«.
Der »historische Geist«, die Fülle der inneren Beziehungen zu räumlich und zeitlich ferneren Interessen, macht uns immer empfindlicher gegen die Schocks und die Wirrnisse, die uns aus der unmittelbaren Nähe und Berührung der Menschen und der Dinge kommen.
Als eine Hauptursache jener Berührungsangst aber erscheint mir das immer tiefere Eindringen der Geldwirtschaft, das die naturalwirtschaftlichen Verhältnisse früherer Zeiten mehr und mehr zerstört, - wenn auch dieses Zerstörungswerk noch nicht völlig gelungen ist.
Das Geld schiebt sich zwischen Mensch und Mensch, zwischen Mensch und Ware, als eine vermittelnde Instanz, als ein Generalnenner, auf den erst jeder Wert gebracht werden muss, um sich weiterhin in andere Werte umsetzen zu können.
Seit der Geldwirtschaft stehen uns die Gegenstände des wirtschaftlichen Verkehres nicht mehr unmittelbar gegenüber, unser Interesse an ihnen bricht sich erst in dem Medium des Geldes, nicht ihre eigene sachliche Bedeutung, sondern wie viel sie, an diesem Zwischenwert gemessen, wert sind, steht dem wirtschaftenden Menschen vor Augen; unzählige Male macht sein Zweckbewusstsein auf dieser Zwischenstufe Halt, als auf dem Interessenzentrum und dem ruhenden Pole, während alle konkreten Dinge in rastloser Flucht vorübertreiben, belastet mit dem Widerspruch, dass doch eigentlich sie allein definitive Befriedigungen gewähren können und dennoch erst nach ihrer Abschätzung an diesem charakterlosen, qualitätslosen Massstab ihren Grad von Wert und Interesse erlangen.
So stellt uns das Geld mit der Vergrösserung seiner Rolle in eine immer gründlichere Distanz von den Objekten, die Unmittelbarkeit der Eindrücke, der Wertgefühle, der Interessiertheit wird abgeschwächt, unsere Berührung mit ihnen wird durchbrochen und wir empfinden sie gleichsam nur durch eine Vermittelung hindurch, die ihr volles, eigenes, unmittelbares Sein nicht mehr ganz zu Worte kommen lässt.
So scheinen sehr mannigfaltige Erscheinungen der modernen Kultur einen tiefen psychologischen Zug gemeinsam zu haben, den man in abstrakter Weise als die Tendenz zur Distanzvergrösserung zwischen den Menschen und seinen Objekten bezeichnen kann und der auf ästhetischem Gebiet nur seine deutlichsten Formen gewinnt.
Und wenn damit wieder Phänomene und Epochen wie die naturalistischen und die sensualistischen abwechseln, in denen gerade ein festes Sich-Anpassen an die Dinge, ein Einschlürfen ihrer ungebrochenen Realität, herrschend wird, so darf das nicht irre machen; denn gerade die Schwingungen zwischen beiden Extremen beweisen die gleiche Neurasthenie, der schon jedes für sich allein entstammte.
Eine Zeit, die zugleich für Böcklin und den Impressionismus, für Naturalismus und Symbolistik, für Sozialismus und Nietzsche schwärmt, findet ihre höchsten Lebensreize offenbar in der Form der Schwankung zwischen den extremen Polen alles Menschlichen; ermatteten, zwischen Hypersensibilität und Unempfindlichkeit schwankenden Nerven können nur noch die abgeklärteste Form und die derbste Nähe, die allerzartesten und die allergröbsten Reize neue Anregungen bringen.
In: Die Zukunft. Herausgegeben von Maximilian Harden, 17. Bd. 1896, Nr. 5. vom 31. 10. S. 204-216.